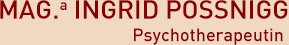Themen
Essstörungen
Ess-Störungen, ob Bulimie, Magersucht oder Übergewicht gehören zu den häufigsten Gründen, warum sich Menschen in Psychotherapie begeben. Frauenberatungsstellen, der schulpsychologische Beratungsdienst und spezielle Zentren für Ess-Störungen haben zunehmend mehr Zulauf. Oft wird sogar die Frage nach stationärer Therapie gestellt.
Die Ess-Störungen
- Anorexie
- Bulimie
- Binge-Eating
- Übergewicht (Adipositas)
gelten nach der heutigen Definition als „Krankheit“. Das bedeutet, dass es sich nicht um eine Disziplinlosigkeit oder ein „sich gehen lassen“ handelt, sondern um eine behandlungsbedürftige Erkrankung, für die der Sozialversicherer auch finanzielle Mittel zur Verfügung stellen muss. Diese Krankheiten haben zum größten Teil psychische Grundlagen, sie können – wenn auch mit ärztlicher Begleitung – durch Psychotherapie behandelt werden.
Verschieden, von der Grundstruktur her
Vom Typ her unterscheiden sich Anorexie, die Magersucht, bei der die Betroffene sehr zart und zerbrechlich wirkt (und es auch ist!) mit sehr geringer Nahrungsaufnahme ganz grundlegend von den Störungen mit großer Nahrungszufuhr. Die jungen Menschen, die an Anorexie leiden sind über lange Zeit sehr gut in ihrem Umfeld eingebettet und zeigen für sich selbst und ihre Angehörigen selten Probleme, außer, dass sie untergewichtig sind. Erst wenn dieses Untergewicht lebensbedrohlich wird, werden Ärzte und Ambulanzen kontaktiert. Die dann verabreichten Infusionstherapien sind oft lebensnotwendig, allerdings müssen die Patientinnen meist anschließend auch psychisch betreut werden. Aus einer Krise kann die Chance zur Veränderung werden.
Unerkannte Gefahr
Bulimie, die sicherlich am weitest verbreitete Ess-Störung bleibt oft über Jahre unentdeckt. Die Betroffenen – meist junge Frauen zwischen 15 und 25 – können die Ess-Störung vor ihrer Familie oder dem Partner verheimlichen. Sie haben meist normales Gewicht und zeigen keine für Laien erkennbare körperlichen Auffälligkeiten. Die Fress-Anfälle finden nur im stillen Kämmerlein statt, oder wenn außer der Bulimikerin niemand im Hause ist. Umso größer ist dann das Entsetzen, wenn die Störung bekannt wird. Nahrungsmittelvorräte werden versperrt, die Betroffene wird kontrolliert und so mancher schlimme Familienkrach ist die Folge.
Immer wieder gibt es Berichte von prominenten Betroffenen. Gerade unter Filmstars, Spitzen-Sportlerinnen und Fotomodells ist die Prävalenz für diese Erkrankungsgruppe sehr hoch. Männer sind sehr selten betroffen. Bulimie, die Ess-Brechsucht ist durch mehr oder weniger häufig auftretende Essattacken gekennzeichnet, die von Erbrechen gefolgt sind. Die Frequenz variiert von einige Male pro Woche bis zu mehreren Anfällen pro Tag. Mit dem halbverdauten Speisebrei werden auch wertvolle Elektrolyte und Magensäure erbrochen. Es kommt zu Verätzungen im Speiseröhren-, Schlund- Gaumen- und Nasenbereich. Die Zähne leiden unter der Aggressivität der Magensäure aber auch unter der Verarmung von körpereigenen Elektrolyten. Haare und Haut zeigen Mangelerscheinungen. Der Stuhlgang ist erschwert. Die meisten Erkrankten leiden an chronischer Verstopfung. Abführmittelmissbrauch verschlimmert die Symptomatik.
Übergewicht…
Binge-Eating-Disorder, eine Ess-Störung, bei der anfallsweise größere Nahrungsmengen ohne Erbrechen aufgenommen werden, führt (natürlich) zu Übergewicht. Diese Krankheit ist auch bei Männern gelegentlich anzutreffen, obwohl hier auch andere Ursachen sehr häufig sind (z.B. hoher Bierkonsum). Bulimie und Binge-Eating könnten vielleicht als zwei Polaritäten einer psychischen Grunderkrankung gesehen werden. Zwischen den Extremformen mit regelmäßigen bzw. gar keinen Erbrechen gibt es zahlreiche Varianten: Abführmittelmissbrauch, Sport-Sucht und Hyperaktivität. Andrerseits steckt gerade in der Abfolge von Essen-Erbrechen auch oft ein starkes Signal der Unentschlossenheit, der Zwigespaltenheit oder Ambivalenz, dass dies auch eine mögliche Grundlage für diese Erkrankung sein kann.
Basis der Erkrankung
Lange wurde eine einzige Ursache für Ess-Störungen gesucht, in einer mechanistischen Welt entspricht das unserem Grundbedürfnis nach einfachen Lösungen. Eine solche Hypothese führt aber meist nicht zum Ziel. Hunger und Essen sind viel zu elementare Vorgänge und eine Störung im Ess-Verhalten hat meist sehr tiefgehende Ursachen.
Eine zunächst oft geäußerte Vermutung ist, dass der Wunsch nach der Modell-Figur, der Modetrend und Zeitgeist, für das Auftreten der Krankheit verantwortlich gemacht werden kann. Dahinter stecken aber vielleicht sehr tiefe Zweifel an der eigenen Person, am Selbstwert und Probleme mit der geschlechtlichen Identifikation. Daher scheint Modebewusstsein bestenfalls der unmittelbare Anlass, nicht die tiefere Ursache zu sein.
Immer wieder geht es in den Therapiegesprächen um Verlusterlebnisse in der frühen Kindheit. Die feinfühligen, kreativen, jungen Menschen, die in ihrer Kindheit manche Enttäuschung oder Verletzung erfahren haben, leiden an einem seelischen Hunger nach Liebe und Zuneigung. Essen ist ein Urbedürfnis des Menschen. Die erste Nahrung kommt von der Mutter. Die Aufnahme der Muttermilch oder das erste Füttern mit dem Fläschchen ist für viele von uns mit dem Gefühl der Wärme und Geborgenheit, mit dem sich Fallen-lassen in die absolute und uneingeschränkte Zuwendung von ihr verknüpft. Niemals ist ein Mensch mehr und vollständiger für jemanden anderen da, als die Mutter für ihr Baby. Die Erinnerung an dieses Gefühl steckt ganz tief in uns drinnen. Doch irgendwann ist diese Zeit vorbei, das Kind wird abgestillt, die Mutter ist nicht mehr für alle unsere Bedürfnisse zuständig. Wer kennt nicht das Gefühl, nach einer Enttäuschung, Frustration oder Niederlage sich etwas Gutes tun, sich mit etwas trösten zu wollen. Für manche ist dies eine Zigarette oder ein Glas Wein. Für andere ein Verlangen nach etwas Essbaren. Da geht es gar nicht so sehr um die Ernährung, vielmehr um ein „inneres Streicheln“. Wenn ich schon niemanden habe, der mich in die Arme nimmt und tröstet, mir Wärme, Liebe und Zuneigung spüren lässt, so möchte ich mir doch selber etwas Gutes tun. Das Essen wird als beruhigend und tröstend erlebt. Die Füllung des Magens sichert -aus der Sicht des Säuglings gesehen – das Überleben für die nächsten Stunden. Nicht umsonst wird Hunger und Durst ge-„stillt“, der Säugling hat nicht wesentlich mehr Bedürfnisse als den vollen Bauch und etwas Wärme. Diese Gefühl der Ruhe und Zufriedenheit wenn der Bauch gefüllt ist, hat sich in uns allen bis ins Erwachsenenalter bewahrt. Nicht umsonst hat gemeinsames Essen in unserer Kultur so einen hohen Stellenwert. Gemeinsam Essen beruhigt, es zeigt, dass wir Vertrauen zum Gastgeber haben.
Essen und Sexualität
Das Essen bzw. der Fress-Anfall der Bulimikerin hat ganz andere Funktion als die der Nahrungsaufnahme oder des sozialen Ereignisses, wie es in unserer Kultur üblich ist. Es unterscheidet sich vom normalen Essen durch die Hast und die Schamhaftigkeit. Die Bulimikerin verweigert die Nahrungsaufnahme in Gesellschaft. Wenn es sein muss, z.B. wenn sie zum Essen eingeladen ist, nimmt sie eine kleine Portion, stochert darin herum und lässt das Meiste stehen. Später, wenn sie daheim und allein ist, gibt sie sich dann ihrer Sucht hin. Der Fress-Anfall wird fast immer im Verborgenen vollzogen. Diese Handlung gehört nur der Betroffnen allein. Auf körperlicher Ebene kommt es zu deutlicher Erregung, im Gehirn werden Endorphine freigesetzt. Der Fress-Anfall und das darauf folgende eruptive Erbrechen haben dadurch mitunter einen erotischen Charakter. Die Parallele zu einer sexuellen Betätigung drängt sich auf.
Für viele der Betroffenen ist die sexuelle Wirklichkeit nicht auslebbar. Sei es, dass sie zu sehr tabuisiert wurde oder aufgrund schlimmer Erfahrungen stark mit Angst besetzt ist. Nicht wenige meiner Klientinnen sind in einer gewaltvollen oder missbräuchlichen Atmosphäre aufgewachsen. Manche junge Frau hatte als Kind sexuellen Missbrauch oder Vergewaltigung erleben müssen. Ihre eigene seelische Entwicklung ist dadurch stark beeinträchtigt. Jede körperliche Annäherung wird als sexuelle Handlung gedeutet, und die ist stark mit Angst verbunden.
Wie anders und wie viel einfacher ist dann der Ess-Anfall. Essen stillt Bedürfnisse auf viel früherer, viel tieferer Ebene als die Sexualität. Lange bevor der Säugling seinen Körper zu erforschen und die Sexualorgane zu entdecken begonnen hat, war das Stillen des Hungers die elementarste Lusterlebnis schlechthin. Wenn nun die Entwicklung zur Sexualität Schmerzen und Enttäuschung bringt, warum nicht zurück gehen zu einer Stufe in der die Welt noch in Ordnung war. So gesehen ist die Ess-Störung Ausdruck der Regression in die frühe Säuglingsphase.
Gewicht, Gefühlsblockaden und Körpergrenzen
Aber auch ohne sexuelle Komponente können Ängste vor der Eigen-Wahrnehmung des Körpers zu Ess-Störungen führen. Der/dem Übergewichtigen ist die Fettschichte eine Form der Abgrenzung – ein Panzer.
Menschen, die als Kind Traumen wie Krankenhausaufenthalte, Krieg oder Verlust einer wichtigen Bezugsperson durchmachen mussten, leben mitunter in einem starken Muskel- oder Fettpanzer. Wie kommt dieser zustande? Für kleinere Kinder sind seelische Schmerzen lediglich körperlich repräsentiert. Ein Kind kann z.B. den Verlust der Mutter tatsächlich durch heftigste Brust- (Herz-) oder Bauchschmerzen spüren. Der seelische Schmerz bzw. der Anlass dazu gerät vielleicht in Vergessenheit, vielmehr: er wird ins Unbewusste verdrängt.
Der Körper leidet aber in der Folge jedes Mal, wenn neue seelische Probleme auftreten. Dadurch etabliert sich letztlich eine Ablehnung der eigenen körperinternen Gefühlsrepräsentationen.
Die Sensibilität für die eigenen Gefühle wird geringer. Denn alle körperliche Gefühle sind stark mit der ins Unbewusste verdrängten Erinnerung an Schmerzen, an den Verlust und an das Alleinsein verknüpft. Essen und Gewichtszunahme dämpfen diese Schmerzen. Hier gibt es ganz unwahrscheinliche starke Panzerungen. Manche 150 Kilo Frau wirkt nach außen stark und unverwundbar. Der „Dicken“ wird Phlegma und Ausgeglichenheit nachgesagt. Man nennt sie „Gemütsmensch“, weil man glaubt, sie bringe nicht so bald etwas aus der Fassung. Im Inneren aber ist sie labil, empfindsam und unglücklich. In der Therapie stellt sich heraus, welche große Zahl von Verwundungen und Demütigungen sie hinnehmen musste, bevor sie die feindlich gesinnte Umgebung ihrer Kindheit verlassen konnte. Das Übergewicht ist zum wesentliche Bestandteil der Körpergrenze geworden. Gefühle zu erleben ist erschwert, daher wirkt sie, als sei sie „hart im Nehmen“. Sie aber ist gewohnt sich nicht zu sehr zu erregen, denn das strengt an. Die Andern nützen ihren Gleichmut und ihre Hilfsbereitschaft aus und sehen die Tragödie nicht, die sich hinter dem Panzer abspielt. Gefühle werden immer mehr zurückgedrängt, Nähe wird zur Gefahr. Der Fettpolster macht uns scheinbar unverwundbar, aber die feinfühlige zarte Persönlichkeit lebt unter der Panzerung. Wird sie freigesetzt, friert sie in einer Welt der Verletzungen und des harten Wettbewerbs.
Vom Problem zum Projekt
Ab einem gewissen Zeitpunkt werden sich alle von Ess-Störungen Betroffenen bewusst, dass diese Krankheiten ein Problem sind. Übergewicht, Elektrolytverlust oder Magersucht sind als ernsthafte körperliche Krankheiten ähnlich einer Sucht oder der Zuckerkrankheit eine entscheidende Bedrohung für die Gesundheit oder sogar das Leben.
Aber es ist ein weiter Weg, vom Erkennen der Gefahr über den Entschluss bis hin zur entscheidenden Verhaltensänderung. Zahlreiche Versuche werden unternommen, viele Ressourcen ausgeschöpft. Die Veränderungen sind nicht leicht, oft schmerzhaft aber notwendig. Am sinnvollsten erscheint es – ähnlich wie in der Projektarbeit – das Ziel langfristig ins Auge zu fassen und alle nötigen Schritte zum gegebenen Zeitpunkt einzuleiten.
Therapie
Psychotherapie: Nach dem bisher Gesagten wird klar, dass diese ein wesentlicher Ansatz einer Behandlung ist. Obwohl „Behandlung“ – als passiver Vorgang gemeint – nicht ganz passt. Der aktive Wunsch zur Veränderung und die eigenen Schritte sind wesentlich für den Erfolg. Die Betroffene entscheidet sich selbst, eine Veränderung in Angriff zu nehmen. Bereits durch die Eigenständigkeit dieses Schrittes, des Entschlusses zur Psychotherapie ist viel in Bewegung geraten. Oft werden Bulimikerinnen von Angehörigen, Freunden, dem Hausarzt oder Lehrern zur Therapie gedrängt, auch dann ist guter Erfolg wahrscheinlich, leichter aber ist der Einstieg in die Therapie ohne „Zuweiser“.
Über Beratungsstellen und Ambulanzen zugewiesen ist am sinnvollsten der Beginn mit Einzelpsychotherapie. Immer wieder wird nach der Methode gefragt, welche am besten sei. Die Antwort ist, es geht nicht um die Methode der Therapie, sondern um die Beziehung der Klientin zur TherapeutIn. Nur wenn diese gut ist, und frei und offen, ohne Tabus über alles gesprochen werden kann, ist eine Therapie sinnvoll.
Die therapeutischen Methoden spielen dann eine untergeordnete Rolle. Andrerseits ist zu bedenken, dass die systemische Familientherapie oft einen sehr raschen und effizienten Einstieg bietet und die Probleme der Betroffenen mit ihrer Umgebung zunächst in den Mittelpunkt rückt. Verhaltenstherapie zielt primär auf eine Modifikation des Ess-Verhaltens ab, klientenzentrierte und analytische Therapien, so wie auch die Gesprächstherapie nach Rogers gehen sehr rasch auf die Entwicklungsgeschichte der Betroffenen ein.
Am günstigsten scheint es, wenn die TherapeutIn einige Techniken, einige Werkzeuge anbieten kann um der Klientin möglicht rasch die passende Möglichkeit zu geben ihre Probleme in den Griff zu bekommen.
Mitunter ist auch ärztliche Hilfe erforderlich: dies ist dann der Fall, wenn die Ess-Störung die Betroffene bereits sehr ausgelaugt hat und starker Elektrolyt-Verlust zu befürchten ist. Auch kann es mitunter erforderlich sein ein Medikament gegen Depressionen einzunehmen, schmerzhafte Änderungen können so manches auslösen.
Stationäre Therapien sind nur dann sinnvoll, wenn sie nicht als einzige (passive) Maßnahme gesetzt werden, als Tropfen auf den heißen Stein, sondern Teil eines umfassenden Therapiekonzeptes sind. Hier spielt dann weniger die medikamentöse Behandlung eine Rolle, sondern vielmehr Gruppentherapie, die als Blick in die eigenen blinden Flecken gelten, sowie bei der Umkonditionierung des Ess-Verhaltens helfen.
Nach der stationären Therapie wird die Betreffende langsam wieder ins „normale“ Leben zurückkehren. Hier ist die Stütze durch Einzeltherapie oft sehr hilfreich. Meist ist gerade das der Zeitpunkt größerer Veränderungen.
Die Therapie der Ess-Störungen dauert meist mehrere Jahre. Manche meiner Klientinnen, die sich bereits als geheilt betrachten, suchen mich dennoch sporadisch auf. Sei es um vereinzelte Probleme im sicheren Rahmen zu reflektieren, sei es um sich die eine oder andere Ressource zu holen. Psychotherapie wird mit Wohlfühlen und bewusst-leben gleichgesetzt.
Die Prognose der Ess-Störungen ist unter Therapie gut. Wenn diese Erkrankung auch langwierig ist, so sind doch nach fünf bis 10 Jahren fast 90% der Klientinnen als erfolgreich zu bezeichnen. Meist ist gerade das Annehmen-Können von Hilfe der entscheidende Schritt für einen langfristigen Erfolg.
Ich möchte jeder Betroffenen Mut machen, „ihre“ Ess-Störung selbst in die Hand zu nehmen. Es dauert sicherlich einige Zeit bis sich Erfolge zeigen, aber die Gesundheit ist unser höchstes Gut und unser Leben die einzige Chance, die wir haben.